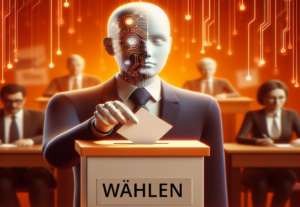Willkommen in der Welt des politischen Theaters, wo das Kriegsrisiko plötzlich sein Comeback feiert. Alle rüsten wie wild auf. Ein großes Fest für alle Rüstungsbetriebe. Der neue Wettbewerb heisst – wer kann in kürzester Zeit mehr Panzer, Drohnen, Haubitzen, Munition produzieren und in den Testmarkt Ukraine werfen. Die Bürger schauen zu, geniessen den Wohlstand und fröhnen dem Populismus.
Rechte Parteien gewinnen Stimmen über Stimmen und baschen gegen die Regierung. Hurra. Nebenschauplätze wie – ob jemand unter Wahrheitspflicht so oder so gesagt hat, Kinder-Theater: Du hast nicht Recht, ich hab Recht – werden zum Gerichtsfall mit Ausmassen wie bei einem Wirtschaftskrimi bei dem der Staat Milliarden und hunderttausende ihren Job verlieren. Schaun wir einmal wer Recht hat – Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft hilft immer. Solche Themen sind für Politiker und Medien gleichermassen ideal und sorgen für mehrere Wochen für Schlagzeilen, Doppelseiten und große Aufregung in der Bevölkerung. Die Medien befeuern den Spektakel und profitieren auch noch von dem bunten Treiben. Die Leserzahlen steigen. Wir Bürger sitzen erste Reihe Fussfrei und schauen entspannt dem bunten Treiben zu.
Die Autokraten – Russen, Chinesen, Türken, Ungarn und viele andere freuts. Sie rüsten auf. Je gespaltener die Gesellschaft, je schwächer die Regierungen, je phlegmatischer die Bürger umso besser. Keiner will wahrhaben wie diese Entwicklung von der Lösung der echten, existenziellen und inzwischen bedrohlichen Problemen ablenkt und unendlich Steuermittel schluckt, die woanders wesentlich besser angelegt sind..
Nach über 70 Jahren relativen Friedens kann man sich dann schon mal fragen: Hat die Demokratie, die uns den Wohlstand beschert hat, ihren Zenit überschritten? Folgen wir dem Weg des Untergangs des römischen Reiches?
Ich möchte versuchen, mit einem Rundgang durch historische Schlammschlachten und der Verbindung zu aktuellen Politikdramen Licht ins Dunkel zu bringen.

Akt 1: Populismus und der Tanz auf dem Pulverfass
Da schlagen politische Parteien schon seit längerem, sehr erfolgreich, den Weg des Populismus ein – ein wirklich beruhigender Trend. Wenn populistische Parolen den Diskurs dominieren, geraten demokratische Institutionen ins Wanken. Das Kriegsrisiko steigt besonders dann, wenn Regierungen schwächeln, Agression und Gewalt verharmlost, wichtige Institutionen einer Demokratie, wie das Demonstrations und Streikrecht für Extremismus missbraucht wird und Populisten das Publikum mit einfachen Lösungen und Regierungsbashing aufheizen.
Welche Rolle spielen in diesem Drama die Medien? Sind sie sich ihrer Verantwortung und der Konsequenzen ihres Handelns, bewusst? Hoffentlich NEIN. Nur dann wird sich etwas ändern. Medien haben in dem ganzen Spiel eine entscheidende Rolle – mal sehen, ob sie sich ihrer Verantwortung stellen oder lieber weiter Aufreger generieren und den Protagonisten auf beiden Seiten viel Raum einräumen. Im Interesse der Öffentlichkeit und der Leser. Fakten von Fake-News trennen ist zu wenig.
Durchschaubare Spiele, Intrigen und Respektlosigkeit zu kritisieren, wäre ihre Aufgabe. Medien müssen die Chance nutzen mit Ihren mächtigen Kommunikations-Instrumenten, im Interesse der Bürger, für essentielle Themen realisierbare Lösungen zu fordern. Vor einem Krieg stehen immer Konflikte, harte Worte, Gewalt und der Verlust von Respekt und Wertschätzung. Parlament und Strasse sind nicht die richtigen Orte für Tribunale und Extremismus. Offensichtlichem Populismus darf keine Zeile mehr gegönnt werden. Es ist 5 vor 12. Wacht auf!
Akt 2: Ignoranz und das Spiel mit dem Feuer
Ob bewusste oder unbewusste Ignoranz, zuschauen, wegschauen und nicht handeln ebnet das Feld für jene, die in dieser Situation ihre Macht ausbauen und in Ruhe alle Maßnahmen ergreifen können um auf Lebenszeit „Volkskanzler für alle Bürger“ zu werden. Autokraten, wie Putin, Xi, Erdogan, oder Orban haben gezeigt wie es in modernen Demokratien geht. Trump, Kikl, LePen oder Weidel folgen den erfolgreichen Rezepten und sie werden auch bei uns funktionieren, so, wie sie auch schon im alten Rom, im Mittelalter und in der Neuzeit im Islamismus funktionierten. Der sichere Weg zunächst zur autokratischen Demokratie, dann zur Diktatur. Krieg spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Wenn für den Autokraten:in (bewustes Gendern) seine Macht in Gefahr ist greift er seit Jahrhunderten zum Krieg. Krieg verbindet und lenkt ab.
Alle Ergebnisse der Demoskopie in den letzten 10 Jahren, und vieleicht auch immer schon zuvor, zeigen eine immer größer werdende Abkehr von der Politik. Politikverdrossenheit entsteht u.a. wenn es den Bürgern zu gut geht oder wenn politische Entscheidungsträger die Sorgen der Bürger ignorieren. Genau so wird der Boden für Unzufriedenheit und Konflikte bereitet. Ein Eldorado für Populisten, die immer einfache Lösungen, Intrigen und Bashing im Repertoire haben. Die Demoskopen wissen es schon lange: Das funktioniert. In diesen unsicheren Zeiten ist es daher umso wichtiger, dass Politiker die Bürger ernst nehmen und die Medien ihre Rolle nutzen, um den demokratischen Meinungsbildungsprozess zu fördern – leider oft ein verpasster Akt.
Akt 3: Das Pulverfass Europa
Es scheint als ob 70 Jahre Frieden schon zuviel waren. Die Geschichte Europas zeigt: Kriegsgefahren kündigen sich oft früh an, werden aber gerne ignoriert. Bis das Fass voll ist und es knallt. Die Rolle der Bürger in einer langen Ära ohne Krieg wird zum Knackpunkt. Wenn sie das Gefühl haben, übergangen zu werden, drohen Unzufriedenheit und soziale Spannungen.
Europa, das Land der Romantik, hat in den letzten 150 Jahren eine beeindruckende Sammlung von Kriegen und Konflikten vorzuweisen.
Angefangen bei „Wer hat den besseren Thron?“ bis hin zu „Territoriale Dispute, weil Grenzen so 19. Jahrhundert sind.“ Diese Kriege wurden inspiriert von einer Mischung aus Ego, Gier und der Unfähigkeit, diplomatisch zu flirten. Wer braucht schon langweiligen Frieden, wenn man eine fesselnde Playlist von Kriegsballaden haben kann? 5 Beispiele denen Imperialismus zu Grunde liegt. Schon vergessen?
Der Erste Weltkrieg (1914-1918):
Auslöser: Komplexes Netzwerk aus Bündnissen, imperialen Rivalitäten und nationalen Spannungen. Der Attentat von Sarajevo auf Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Ungarn war nur der Funke, der das Pulverfass zündete.
Der Zweite Weltkrieg (1939-1945):
Auslöser: Expansionistische Ambitionen von Nazi-Deutschland, der Überfall auf Polen 1939, gefolgt von den aggressiven Handlungen anderer totalitärer Regime.
Der Jugoslawien-Krieg (1991-2001):
Auslöser: Der Zusammenbruch Jugoslawiens, ethnischer Nationalismus und territorialer Ansprüche führten zu einem blutigen Konflikt, als verschiedene Republiken ihre Unabhängigkeit erklärten.
Der Kosovokrieg (1998-1999):
Auslöser: Unterdrückung der ethnischen Albaner im Kosovo durch Serbien führte zu internationalen Spannungen. NATO intervenierte, um das Massaker zu stoppen und die Unabhängigkeit des Kosovo zu fördern.
Der Konflikt in der Ukraine (seit 2014):
Auslöser: Annexion der Krim durch Russland und Spannungen um die politische Ausrichtung der Ukraine. Der Konflikt im Osten entzündete sich aufgrund von Separationsbestrebungen und geopolitischen Einflüssen.
Extremismus und gespaltene Gesellschaften sind dann nur noch einen Schritt entfernt – ein Blick in die USA mit dem Sturm auf das Kapitol genügt.
Akt 4: Maßnahmen zur Wiedererlangung einer stabilen, starken Demokratie
In einer stabilen Demokratie müssen Maßnahmen ergriffen werden, um gesellschaftliche Spaltung und das Risiko eines Bürgerkriegs oder imperialistische Ideen zu minimieren.
-
Dialogförderung: Offener Meinungsaustausch ohne persönliche Angriffe schafft Verständnis für unterschiedliche Perspektiven.
-
Verantwortungsbewusste Medienlandschaft: Qualitätsjournalismus und objektive Berichterstattung helfen, Fehlinformationen zu reduzieren.
-
Politische Bildung: Kritisches Denken und Verständnis für politische Prozesse fördern, damit Bürger fundierte Entscheidungen treffen können.
-
Einbindung der Bürger: Aktive Teilnahme an bürgerschaftlichen Aktivitäten stärkt das Vertrauen in die Politik.
-
Transparenz fördern: Regierungen müssen Entscheidungsprozesse offenlegen, um das Vertrauen der Bürger zu gewinnen.
-
Bewusste Wahlbeteiligung: Bürger sollten ihre Stimmen bewusst abgeben, basierend auf den politischen Programmen und Werten der Kandidaten.
Diese Maßnahmen und noch viele weitere, könnten dazu beitragen, die Grundlagen für eine harmonische und stabile Gesellschaft in einer Demokratie zu festigen. In diesem Drama namens Politik liegt es an uns, die Hauptrolle zu übernehmen und den Vorhang für eine Ära konstruktiver Politik zu heben. Am Ende des Tages sind es die Bürger, die den Applaus geben – oder im Schweigen verharren.