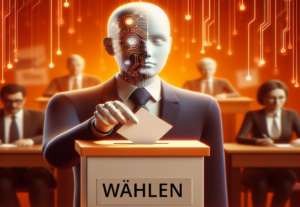Argentiniens neuer Präsident Milei provoziert mit radikalen Wirtschaftsreformen.
In einem historischen Akt sieht sich der frisch gewählte Präsident Javier Milei mit einem Generalstreik konfrontiert, der unmittelbar nach seinem Amtsantritt in Argentiniens Geschichte stattfindet.
Die größte Gewerkschaft des Landes ruft aus Protest gegen Mileis drastische Wirtschaftsreformen zu einem Generalstreik am 24. Januar auf, wie bereits Ende Dezember vom Gewerkschaftsbund CGT angekündigt.

Ironischerweise haben Teile der Arbeiterschaft Milei gewählt, in der Hoffnung, dass die ‚politische Kaste‘ die Krise tragen würde. Jetzt wird deutlich, dass er stattdessen die Last auf die Arbeiterschaft abwälzen will, so Daniel Yofra, Generalsekretär der dem CGT angegliederten ‚Föderation der Beschäftigten der Speiseölindustrie‘, gegenüber der Tageszeitung Junge Welt.
Milei hatte bei seinem Amtsantritt am 10. Dezember 2023 eine „Schocktherapie“ für das hochverschuldete Land angekündigt, die er rasch umsetzte. Das sogenannte Mega-Dekret, das etwa 300 Regelungen ändern und 300 weitere aufheben soll, umfasst die Deregulierung des In- und Außenhandels, die Aufhebung der Mietbindung, die Beschneidung von Arbeitsrechten und die Privatisierung öffentlicher Unternehmen.
Die Beschränkung der Arbeitnehmerrechte zeigt sich in der Verlängerung der Probezeit auf bis zu acht Monate und dem Verbot von Betriebsblockaden. Auch das Streikrecht wird eingeschränkt, indem die Hälfte der Produktion in als „wesentlich“ definierten Bereichen während eines Streiks aufrechterhalten werden muss.
Bereits kurz nach Erlass des Mega-Dekrets im Dezember kam es zu Protesten in Buenos Aires, bei denen Tausende gegen die Reformen auf die Straße gingen. Die Gewerkschaften in Uruguay und Frankreich kündigten ihre Unterstützung für den Generalstreik an. Argentiniens Präsident Milei steht vor einer politischen Feuerprobe, die die nationale und internationale Gemeinschaft aufmerksam verfolgt.
Zur Rechtfertigung seiner drastischen Maßnahmen beruft sich Milei auf einen „öffentlichen Notstand“ in wirtschaftlichen, finanziellen, steuerlichen, administrativen, Renten-, Tarif-, Gesundheits- und Sozialangelegenheiten. Er argumentiert, dass bisherige Ansätze gescheitert seien und dringendes Handeln erforderlich sei.
Populisten, die mit lautstarken Versprechen an die Macht gelangen, stellen oft eine Gefahr für die demokratischen Prinzipien dar. In diesem Artikel werfen wir einen nüchternen Blick darauf, was geschieht, wenn Populisten ihre Ankündigungen gegen die Interessen einer Mehrheit durchsetzen und dabei auch Gewalt als Mittel einsetzen. Ein genauerer Blick auf die politischen Wege von Trump und Orban liefert Einsichten in die Methoden und Konsequenzen populistischer Macht.
Donald Trump, als Beispiel aus den USA, führte eine Kampagne, die von polarisierenden Versprechen geprägt war. Seine Forderungen nach einer Mauer an der Grenze zu Mexiko und der Einreisebeschränkungen für bestimmte Länder trafen auf Beifall bei seiner Basis, jedoch riefen sie auch erheblichen Widerstand hervor. Als Trump diese Versprechen umsetzte, stieß er auf Widerstand im eigenen Land und internationaler Kritik. Die Spaltung der Gesellschaft vertiefte sich, und die demokratischen Prinzipien gerieten unter Druck.
Viktor Orban in Ungarn verfolgte eine ähnliche Linie. Mit dem Fokus auf nationalen Interessen und der Einschränkung von Minderheitenrechten gewann er an Zustimmung. Doch die Umsetzung dieser Versprechen brachte Ungarn in Konflikt mit der EU und internationalen Menschenrechtsorganisationen. Orban nutzte politische Instrumente, um die Kontrolle über Medien und Institutionen zu stärken, was zu Vorwürfen der Einschränkung der Meinungsfreiheit führte.
Die Vorgehensweisen von Milei, Trump und Orban zeigen, dass populistische Versprechen nicht zwangsläufig im Einklang mit den Interessen einer Mehrheit stehen. Die Umsetzung solcher Versprechen kann zu Spaltung, internationalen Konflikten und einer Erosion demokratischer Werte führen.
Es bleibt die Frage, wie sich Gesellschaften vor den negativen Auswirkungen populistischer Machtausübung schützen können. Die Antwort liegt möglicherweise in einer aufgeklärten Bürgerschaft, einer starken Zivilgesellschaft und dem Schutz demokratischer Institutionen. Der Blick auf die Erfahrungen mit Trump und Orban mahnt dazu, die Prinzipien der Demokratie zu verteidigen und populistischen Verlockungen mit einer kritischen Haltung zu begegnen.